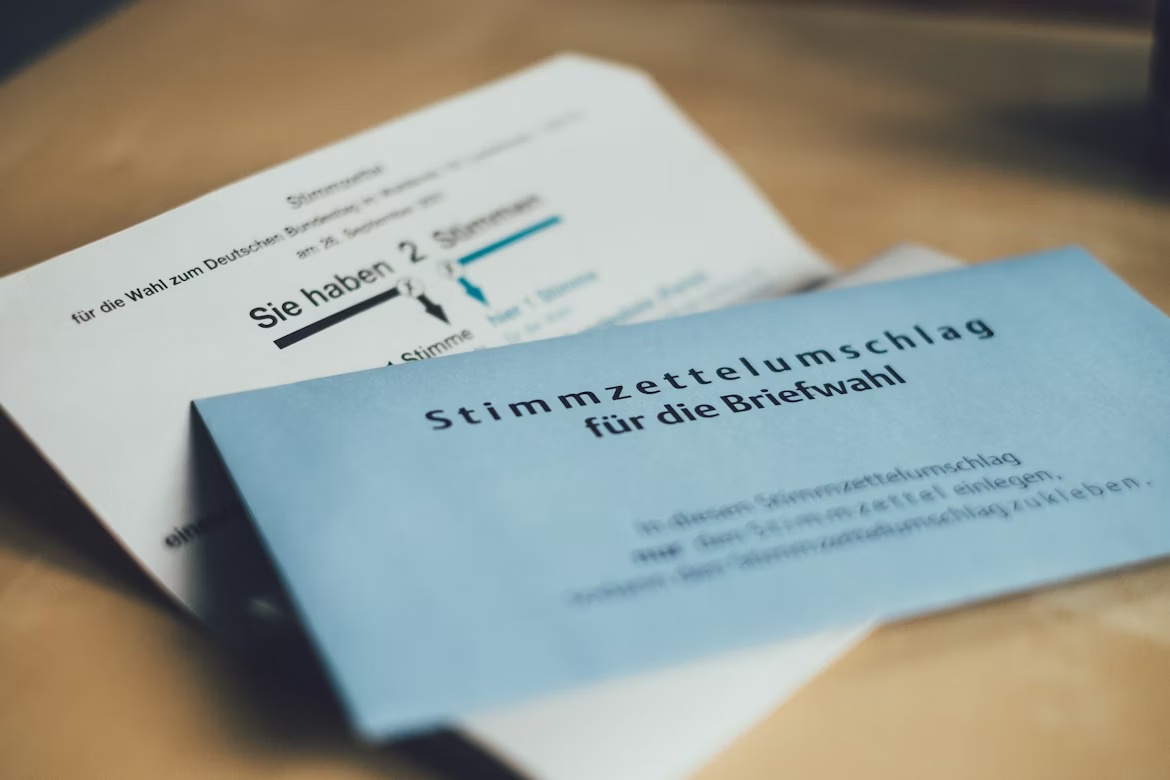Fühlen Sie häufig ein Gefühl der inneren Leere? Oder fühlen Sie sich oft zurückgewiesen? Sollte dem so sein, gehören Sie möglicherweise zu den (je nach Studie) 11 bis 12% der Deutschen, die einsam sind. Doch was heißt das eigentlich, einsam zu sein? Und was macht es mit einer Gesellschaft, wenn sich mehr als jedes zehnte ihrer Mitglieder so fühlt?
Einsamkeit ist nach der gängigen Definition der amerikanischen Psychologen Daniel Perlman und Letitia Anne Peplau ein unangenehmes Gefühl, das entsteht, wenn das persönliche soziale Netzwerk als entweder zu klein oder zu wenig intim wahrgenommen wird. Aufbauend auf dieser Definition lässt sich Einsamkeit weiterhin in emotionale Einsamkeit, also dem Fehlen intimer persönlicher Beziehungen, und soziale Einsamkeit, die auftritt, wenn das eigene soziale Netzwerk als zu klein empfunden wird, unterscheiden.
Zentral für beide Einsamkeitskeitsdefinitionen vor allem ihr subjektiver Charakter: Wer tatsächlich wenig soziale Kontakte hat, der ist nicht zwingend einsam. Menschen, die sich bewusst aus der Gesellschaft anderer zurückziehen, können dies als durchaus angenehm empfinden. Auf der anderen Seite heißt das auch, dass Menschen, die objektiv betrachtet ein großes soziales Netzwerk oder eine Familie haben, sich einsam fühlen können. Zwar korrelieren objektive soziale Isolation und Einsamkeit miteinander und soziale Isolation gehört zu den Risikofaktoren für Einsamkeit, dennoch sind sie voneinander zu unterscheiden.
Doch warum sollte sich die Politikwissenschaft der Einsamkeit widmen? Ist das nicht eher ein Thema der Soziologie oder Psychologie? Diese bewusste Vereinfachung verkennt die politische Dimension von Einsamkeit. Um dies zu präzisieren möchte ich zwei (politikwissenschaftliche) Perspektiven auf Einsamkeit erläutern:
Zum einen betrifft Einsamkeit die gesundheitspolitische Dimension. Zahlreiche Studien weisen nach, dass sich Einsamkeit extrem negativ auf die Gesundheit auswirkt: von erhöhten Risiken für Herz-Kreislauf oder chronische Erkrankungen wie Diabetes über eine generell erhöhte Sterblichkeit und massiv erhöhten Risiken für psychische Erkrankungen wie Depression, Angststörungen oder Demenz; Einsamkeit ist ein multifaktorielles Gesundheitsrisiko. Vor dem Hintergrund eines Gesundheitssystems, dass knapp finanziert ist und in einer Versorgungskrise steckt, wird die gesundheitspolitische Relevanz des Problems deutlich.
Einige Länder haben dies bereits erkannt: In Großbritannien und Japan sollten designierte „Einsamkeitsminsterien“ der Einsamkeit und ihren Folgen begegnen und auch in Deutschland gibt es Stabsstellen zur Einsamkeitsbekämpfung (etwa in Nordrhein-Westfalen). Diese staatlichen Initiativen sind zu begrüßen, so kann der Staat viele der Ursachen von Einsamkeit tastsächlich direkt beeinflussen: Armut als einer der größten Risikofaktoren lässt sich nachweislich etwa durch einen starken Sozialstaat reduzieren. Und auch die Qualität von Nachbarschaften, die einen großen Beitrag zur Senkung von Einsamkeit leisten können, lässt sich durch steuerungspolitische Maßnahmen wie der Förderung von Nachbarschaftstreffpunkten oder -initiativen stärken.
Nun ist die gesundheitspolitische Dimension von Einsamkeit bereits seit längerer Zeit bekannt und im Fokus der Politik. Doch Einsamkeit hat eine weitere Konsequenz, die möglicherweise weitaus nachhaltiger schädliche Konsequenzen für unsere Gesellschaft nach sich zieht. Die Politiktheoretikerin und Philosophin Hannah Arendt erklärt in Ihrem Werk „Die Ursprünge totalitärer Herrschaft“ den Aufstieg des NS-Regimes durch den, in der modernen Gesellschaft vereinsamten, „Massenmenschen“, welcher erst Anschluss und Zugehörigkeit in der totalitären NS-Bewegung fand. Diese Zugehörigkeit durch Abgrenzung ist es laut Arendt, welche vormals mehr oder weniger unpolitische Menschen radikalisiert und das Fundament totalitärer Bewegungen bildet.
Diese These Arendts lässt sich mithilfe der Sozialpsychologie näher erklären: In ihrem einflussreichen „Evolutionären Model der Einsamkeit“ beschreiben Stephanie und John Cacioppo Einsamkeit als Artefakt der menschlichen Evolution. Da sozialer Kontakt und das Angehören zu einer Gruppe dem Menschen einen essentiellen Vorteil brachten, entwickelte sich Einsamkeit, ähnlich dem Schmerzreiz, als ein Verhaltenssteuerungsmechanismus. Wer keine sozialen Kontakte pflegt, der fühlt sich einsam und ist so intrinsisch motiviert, dies zu ändern.
Allerdings hat dieser Mechanismus auch eine Kehrseite: Da, besonders in der frühen menschlichen Geschichte, unüberlegter Kontakt zu Fremden gefährlich seien konnte, führt Einsamkeit zugleich zu einer deutlich gesteigerten Bedrohungswahrnehmung. So ist sichergestellt, dass besonders Beziehungen im engen sozialen Umfeld priorisiert geknüpft und repariert werden und Betroffene kein unnötiges Risiko durch ihren Einsamkeitstrieb eingehen. Gleichzeitig wird ein Kompensationseffekt ausgelöst: Um den Nachteil auszugleichen, der einsamen Menschen durch den fehlenden positiven sozialen Kontakt entsteht, neigen sie dazu, diesen Mangel durch egoistisches Handeln zu kompensieren.
Diese von den Cacioppos postulierte Theorie stützt sich auf zahlreiche neurologische und psychologische Befunde. Tatsächlich zeigen einsame Menschen in verschiedenen klinischen Studien eine deutlich erhöhte Wahrnehmung bedrohlicher sozialer Signale und interpretieren soziale Situationen als weniger positiv. Gleichzeitig zeigen Experimente, dass einsame Menschen seltener prosoziales Verhalten wie ehrenamtliches Arbeiten zeigen und deutlich niedrigeres Vertrauen in ihre Mitmenschen haben.
Diese individuellen Auswirkungen von Einsamkeit haben natürlich auch Folgen für die Gesellschaft. Geringes interpersonelles Vertrauen und erhöhte Bedrohungssensitivität gelten in der Sozialpsychologie als gut erforschte Faktoren zur Erklärung negativer Einstellungen. Auch wenn die Forschung bezüglich Einsamkeit im Speziellen noch am Anfang steht, legen zahlreiche Studien bereits negative Effekte von Einsamkeit auf politische Einstellungen nahe: Einsame Menschen empfinden geringere politische Wirksamkeit, vertreten häufiger extreme und menschenfeindliche politische Ansichten wie Rassismus, Autoritarismus oder Frauenfeindlichkeit, glauben häufiger an Verschwörungstheorien, lehnen eher politischen Pluralismus ab und billigen häufiger politische Gewalt.
Ebenso lassen sich Effekte auf das politische Verhalten identifizieren: Zwar nehmen einsame Menschen häufiger an Demonstrationen teil, jedoch auch deutlich seltener an Wahlen. Diesen vermeintlichen Widerspruch erklärt der Soziologe Alexander Langenkamp mit der Erwartungshaltung an die Beteiligungsformen: Bei einer Demonstration kann ich möglicherweise neue Kontakte knüpfen oder bestehende vertiefen; der Akt der Wahl hingegen ist individuell und anonym. Aber nicht nur ob, sondern auch wer gewählt wird, kann durch Einsamkeit beeinflusst werden. In Übereinstimmung mit den bereits beschriebenen Einstellungsveränderungen wählen einsame Menschen deutlich häufiger rechtspopulistische Parteien. Zudem wird in Studien zu radikalisierten Einzeltätern, etwa aus dem Incel- oder ISIS-Umfeld, Einsamkeit als Risikofaktor für politische Gewalt benannt.
Nach all diesen negativen Auswirkungen der Einsamkeit fragen Sie sich hoffentlich, was wir als Politikwissenschaft unternehmen können, um dieser Entwicklung entgegen wirken zu können. Nun, zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass Einsamkeit nicht stigmatisiert werden darf. Zwar zeigen sich viele besorgniserregende empirische Befunde zu Einsamkeit, dass heißt aber ausdrücklich nicht, dass alle einsamen Menschen menschenfeindlich oder extremistisch denken oder gar handeln. Wie so oft in der empirischen Politikwissenschaft sprechen wir bei diesen Folgen der Einsamkeit über statistische Trends, die nicht auf jeden Betroffenen in gleichem Maße oder überhaupt zutreffen.
Zugleich steht die Forschung noch am Anfang: Es wird, auch aufgrund der noch dünnen Datenlage, selten zwischen emotionaler und sozialer Einsamkeit unterschieden, die Dauer von Einsamkeitserfahrungen bleibt oft unberücksichtigt und viele weitere Aspekte sind noch gar nicht erforscht. Um zu diesen zahlreichen Forschungslücken beizutragen, ist interdisziplinäre wissenschaftliche Arbeit nötig. Glücklicherweise ist hier aber auch viel im Umbruch: Initiativen, wie das Kompetenznetz Einsamkeit oder InLoNe sowie Projekte wie LONELY-EU werden in den nächsten Jahren viele neue Erkenntnisse zu den Auswirkungen von, aber auch Interventionen gegen Einsamkeit liefern. Zudem möchte auch ich mit meinem PhD Projekt einen Teil zum wissenschaftlichen Fortschritt in dieser Frage beitragen.
Zitation: Paul Gies, Einsamkeit – Ein Risiko für Demokratien, Erschienen in „Über Politik
aus der Wissenschaft“, Herausgeber Achim Goerres, 30.06.2025, abrufbar unter
https://www.politik-wissenschaft.org/2025/07/07/einsamkeit-ein-unterschaetztes-risiko-fuer-
demokratien/, DOI: https://doi.org/10.17185/politik-wissenschaft/20250721
Wichtige Literatur zur Vertiefung:
Arendt, Hannah. 1973. The Origins of Totalitarianism. new ed. with added prefaces. New York.
Baumeister, Roy F., und Mark R. Leary. 1995. „The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation“. Psychological Bulletin 117(3): 497–529. doi:10.1037/0033-2909.117.3.497.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2024. „Einsamkeitsbarometer 2024“.
Cacioppo, John T., und Stephanie Cacioppo. 2018. „Loneliness in the modern age: An evolutionary theory of loneliness (ETL)“. In Advances in experimental social psychology., Advances in experimental social psychology., San Diego, CA, US: Elsevier Academic Press, 127–97.
Gierveld, Jenny De Jong, Theo G. Van Tilburg, und Pearl A. Dykstra. 2018. „New Ways of Theorizing and Conducting Research in the Field of Loneliness and Social Isolation“. In The Cambridge Handbook of Personal Relationships, hrsg. Anita L. Vangelisti und Daniel Perlman. Cambridge University Press, 391–404. doi:10.1017/9781316417867.031.
Langenkamp, Alexander. 2025. „Linking Social Deprivation and Loneliness to Right-Extreme Radicalization and Extremist Antifeminism“. Current Opinion in Behavioral Sciences 63: 101525. doi:10.1016/j.cobeha.2025.101525.
Langenkamp, Alexander, Alexander Schmidt‐Catran, und Janosch Schobin. 2025. „It Seems Tense: The Influence of Loneliness on Perceived Social Conflict and Societal Threats“. Political Psychology: pops.70036. doi:10.1111/pops.70036.
Mauri, Caterina, Martina Barjaková, und Francesco Berlingieri. 2024. „Measuring Loneliness: The European Union Loneliness Survey Covering 27 European Countries“. In Loneliness in Europe: Determinants, Risks and Interventions, hrsg. Sylke V. Schnepf, Béatrice d’Hombres, und Caterina Mauri. Cham: Springer Nature Switzerland, 13–39. doi:10.1007/978-3-031-66582-0_2.
Neu, Claudia, Beate Küpper, und Maike Luhmann. 2023. „Studie ‚Extrem einsam? – Die demokratische Relevanz von Einsamkeitserfahrungen unter Jugendlichen in Deutschland‘“.
Peterson, Delaney, Matthijs Rooduijn, Frederic R. Hopp, Gijs Schumacher, und Bert N. Bakker. 2025. „Loneliness Is Positively Associated with Populist Radical Right Support“. Social Science & Medicine 366: 117676. doi:10.1016/j.socscimed.2025.117676.