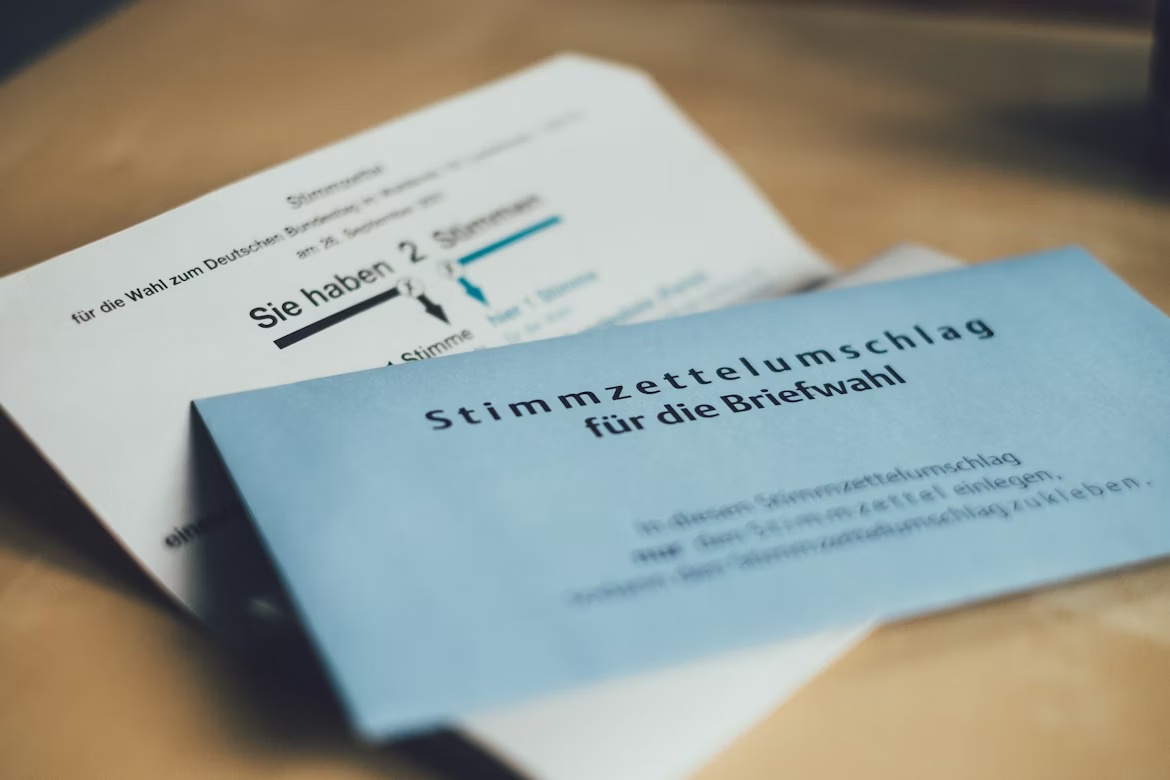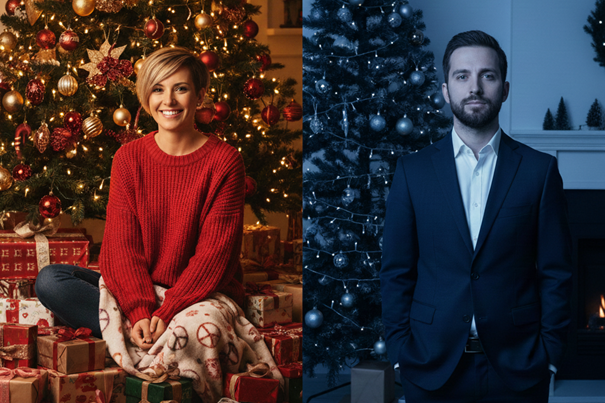Nachbarschaften sind wichtige Interaktionsräume, in denen Menschen miteinander in Kontakt kommen, sich austauschen und sich somit gegenseitig beeinflussen. Dies gilt insbesondere auch für Angehörige von sozialen Minderheiten, beispielsweise Zugewanderte. Aus der Perspektive der Zugewanderten können Nachbarschaften wichtige Einblicke in das soziale und politische Gefüge der Aufnahmegesellschaft bieten. Doch wie genau solche nachbarschaftlichen Prozesse die politische Integration von Zugewanderten beeinflussen, wurde bislang wenig erforscht. Meine Studie „Integration is local: how neighborhood social climate buffers the negative impact of ethnic discrimination on the political trust of immigrants and their descendants“ geht deshalb der Frage nach, welchen Einfluss das soziale Klima in einer Nachbarschaft auf das politische Vertrauen von Zugewanderten haben kann.
Wie hängt die Nachbarschaft mit politischem Vertrauen von Zugewanderten zusammen?
Als politische Integration wird die Eingliederung in das politische System des Aufnahmelandes bezeichnet. Dazu gehören rechtliche Aspekte wie die Annahme der Staatsbürgerschaft, aber auch bestimmte politische Verhaltensweisen und Einstellungen. Politisches Vertrauen, verstanden als Vertrauen in politische Institutionen wie den Bundestag oder die Bundesregierung, ist ein wichtiger Teil politischer Integration. Es zeigt, inwieweit Individuen etablierte politische Institutionen unterstützen und als legitim erachten. Vorangegangene Forschung zu Einflussfaktoren auf das politische Vertrauen von Zugewanderten hat gezeigt, dass wahrgenommene ethnische Diskriminierung das politische Vertrauen mindert und somit ein wesentliches Integrationshindernis darstellt.
Weniger erforscht ist jedoch, inwiefern soziale Interaktionen mit der Aufnahmegesellschaft diese Beziehung beeinflussen. In meiner Studie argumentiere ich deshalb, dass soziale Offenheit und positiver Kontakt zwischen Einheimischen und Zugewanderten in der Nachbarschaft diesen negativen Zusammenhang abmildern können. Soziale Offenheit – die Wahrnehmung, dass Menschen in der Nachbarschaft generell tolerant und offen gegenüber neuen Nachbarn sind – sowie positiver Kontakt sind dabei zwei zentrale Aspekte des nachbarschaftlichen sozialen Klimas. Abbildung 1 verdeutlicht den theoretisch erwarteten Zusammenhang zwischen nachbarschaftlichem sozialem Klima, wahrgenommener ethnischer Diskriminierung und politischem Vertrauen.
Abbildung 1: Theoretisch erwarteter Zusammenhang

Es ist also zu erwarten, dass ein offenes soziales Klima in der Nachbarschaft Zugewanderte mit zusätzlichen Ressourcen ausstattet, um mit den negativen Erfahrungen ethnischer Diskriminierung besser umzugehen und deren potenziell vertrauensuntergrabenden Effekt zu verringern.
Ergebnisse basierend auf der Umfrage „Leben im Viertel“
Um diese Zusammenhänge zu analysieren, werden Daten aus der Umfrage „Leben im Viertel“(„LiV“) genutzt. Diese wurde im Herbst 2022 in 40 Nachbarschaften in zehn deutschen Großstädten durchgeführt. Dabei wurden sowohl Mitglieder der Aufnahmegesellschaft als auch Zugewanderte befragt. Meine Studie konzentriert sich jedoch nur auf die befragten Zugewanderten (N = 878). Die Ergebnisse der statistischen Analyse bestätigen die Erkenntnis aus früheren Studien: Häufig wahrgenommene ethnische Diskriminierung hängt negativ mit dem politischen Vertrauen von Zugewanderten zusammen. Darüber hinaus zeigen die Analysen, dass sowohl soziale Offenheit als auch positiver Kontakt in der Nachbarschaft diesen negativen Effekt abmildern können. Das heißt, in sozial offenen Nachbarschaften, in denen positive Kontakterfahrungen zwischen Zugewanderten und Aufnahmegesellschaft bestehen, wirkt sich wahrgenommene Diskriminierung weniger negativ auf das politische Vertrauen aus.
Abbildung 2: Prognostizierte Werte des politischen Vertrauens in Abhängigkeit von positivem intergruppalen Kontakt in der Nachbarschaft

Abbildung 2 verdeutlicht exemplarisch den abmildernden Effekt von positivem intergruppalen Kontakt in der Nachbarschaft. Auf der x-Achse sind die unterschiedlichen Werte von positivem Kontakt in der Nachbarschaft dargestellt. Je höher der Wert, desto häufiger treten diese Kontakterfahrungen in der Nachbarschaft auf. Auf der y-Achse sind die prognostizierten Werte für politisches Vertrauen dargestellt. Auch hier gilt: Je höher der Wert, desto höher ist das politische Vertrauen. Die schwarze Linie zeigt die Werte für Zugewanderte, die noch nie ethnische Diskriminierung wahrgenommen haben. Die türkise Linie zeigt die Werte für Zugewanderte, die häufig ethnische Diskriminierung wahrnehmen. Es wird deutlich, dass Zugewanderte, die häufig Diskriminierung wahrnehmen, niedrigere Vertrauenswerte aufweisen als Zugewanderte ohne diese Wahrnehmung. Je höher jedoch der positive intergruppale Kontakt in einer Nachbarschaft ist, desto kleiner wird dieser Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Sobald der positive intergruppale Kontakt in der Nachbarschaft überdurchschnittlich hoch ist (d.h. einen Wert von 3,9 überschreitet), ist dieser Unterschied sogar nicht mehr statistisch signifikant. Dies unterstützt die Annahme, dass positiver Kontakt in der Nachbarschaft den negativen Effekt von wahrgenommener ethnischer Diskriminierung auf das politische Vertrauen von Zugewanderten abmildern kann.
Fazit: Nachbarschaftliche soziale Offenheit stärkt politisches Vertrauen von Zugewanderten
Die Ergebnisse dieser Studie haben wichtige praktische Implikationen. Häufig wahrgenommene ethnische Diskriminierung hat schwerwiegende Konsequenzen für das politische Vertrauen von Zugewanderten. Die Politik ist daher aufgefordert, Maßnahmen zur Bekämpfung und Reduzierung von Diskriminierung zu ergreifen, um politisches Vertrauen zu stärken und somit Integration zu fördern. Die Ergebnisse meiner Studie zeigen, dass Nachbarschaften einen wertvollen Ansatzpunkt für solche Maßnahmen darstellen. Denn: ein offenes und willkommen heißendes Klima in der Nachbarschaft, in Form von sozialer Offenheit und positivem Kontakt, kann die negativen Auswirkungen von Diskriminierung auf Vertrauen abmildern und somit das politische Vertrauen von Zugewanderten stärken.
Darüber hinaus spielt ein offenes soziales Klima in der Nachbarschaft nicht nur für Zugewanderte eine Rolle: Eine weitere Studie auf Basis der LiV-Umfrage zeigt, dass sich eine höhere soziale Offenheit in der Nachbarschaft positiv auf die Einstellungen der Aufnahmegesellschaft gegenüber Diversität auswirkt. Angesichts dessen erscheinen Investitionen in das soziale Klima einer Nachbarschaft doppelt sinnvoll, da es Integrationsprozesse sowohl seitens der Aufnahmegesellschaft als auch seitens der Zugewanderten positiv beeinflussen kann.
Literaturhinweise:
Hummler, Teresa. 2025. “Integration is local: how neighborhood social climate buffers the negative impact of ethnic discrimination on the political trust of immigrants and their descendants”. Ethnic and Racial Studies. doi: 10.1080/01419870.2025.2520902
Hummler, Teresa und Conrad Ziller. 2024 “Exploring the role of social openness for pro-diversity attitudes in urban and rural places”. Political Psychology. doi:10.1111/pops.13066
Röder, Antje, und Peter Mühlau. 2011. “Discrimination, Exclusion, and Immigrants’ Confidence in Public Institutions in Europe.” European Societies 13(4): 535–557. doi: 10.1080/ 14616696.2011.597869.
Tyrberg, Maria. 2024. “The Impact of Discrimination and Support on Immigrant Trust and Belonging”. European Political Science Review 16(1): 18–34. doi: 10.1017/S1755773923000139.
Link zur Homepage der LiV-Umfrage: https://www.uni-due.de/liv/
Hinweis:
Dieser Blog basiert auf dem Artikel „Integration is local: how neighborhood social climate buffers the negative impact of ethnic discrimination on the political trust of immigrants and their descendants”, der in Ethnic and Racial Studies veröffentlicht wurde.
Zitation: Teresa Hummler, Integration beginnt im Viertel – Wenn die Nachbarschaft Vertrauen schafft, Erschienen in „Über Politik aus der Wissenschaft“, Herausgeber Achim Goerres, 13.10.2025, abrufbar unter https://www.politik-wissenschaft.org/2025/09/08/visible-state/ DOI: https://doi.org/10.17185/politik-wissenschaft/20251013