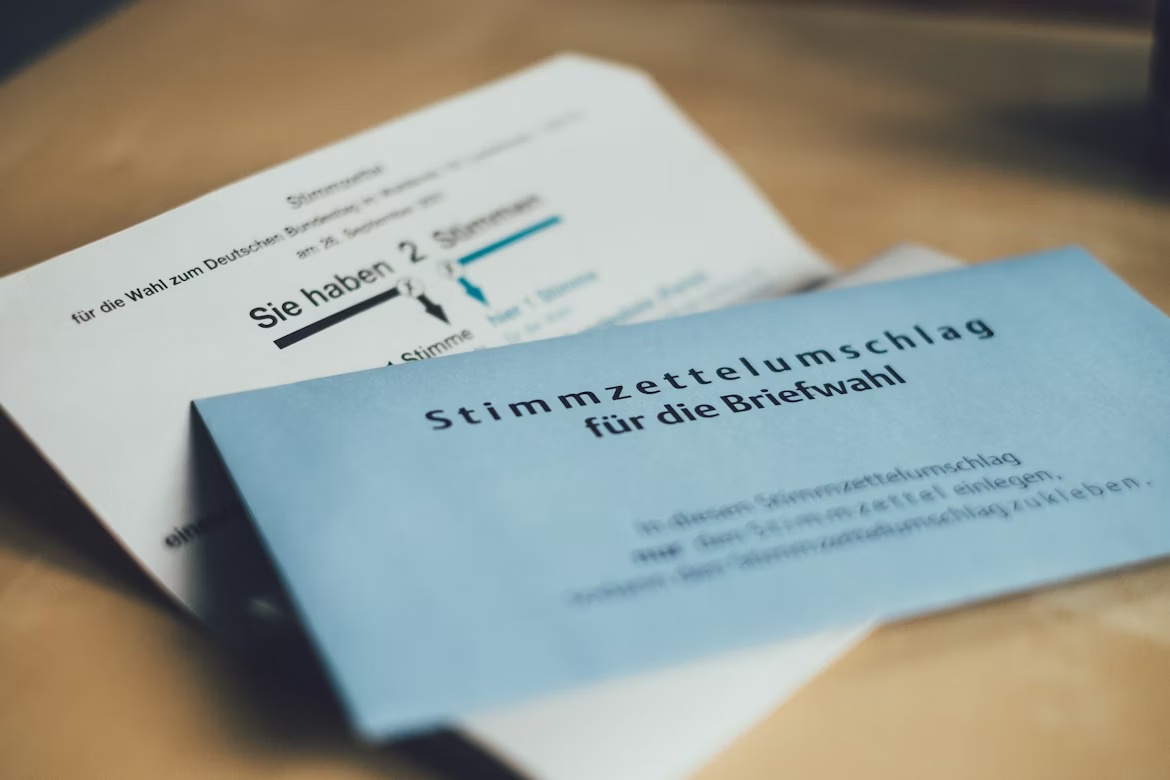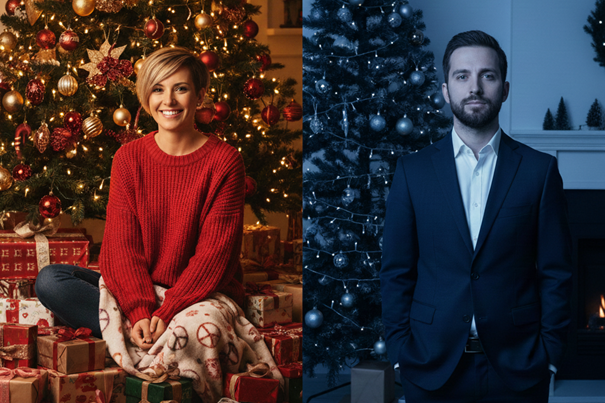Hinweis: Dieser Blog baut auf der Publikation „Ein Teil der Arbeiter:innenklasse? Analyse des Klassenbewusstseins prekär und atypisch Beschäftigter in Deutschland“, zu finden unter (https://www.fes.de/abteilung-analyse-planung-und-beratung/artikelseite-apb/ein-teil-der-arbeiterinnenklasse) auf.
„Die Arbeiter von damals sind die heutigen Dienstleister; die meisten Dienstleistungsberufe heutzutage sind ja eher ungelernte Kräfte“ – dieses Zitat einer 30-jährigen Kundenbetreuerin in einem Fokusgruppengespräch[i] wirft die Frage auf: Wer gehört heute überhaupt noch zur klassischen Arbeiter:innenklasse?
In Zeiten, in denen immer mehr Menschen in prekären oder atypischen Anstellungsverhältnissen beschäftigt sind und unsere Gesellschaft sich immer weiter individualisiert und ausdifferenziert, kann man jedoch gleichzeitig fragen, welche Relevanz soziale Klasse sowohl in der sozialwissenschaftlichen Forschung als auch in der Beschreibung von Gesellschaften heute spielt. In einer Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung gehe ich diesen Fragen nach und beleuchte, wie prekär und atypisch Beschäftigte in Deutschland ihre soziale Stellung wahrnehmen, ob und welche gemeinsamen politischen Präferenzen sie verbindet und welche Schlussfolgerung für Politik daraus gezogen werden können.
Wer sind prekär und atypisch Beschäftigte?
Doch wer sind überhaupt prekär und atypisch Beschäftigte? Beide Gruppen unterscheiden sich von Beschäftigten mit Normalarbeitsverhältnissen, also einer unbefristeten, sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung zwischen einem:einer Arbeitgeber:in und einem:einer Arbeitnehmer:in. Unter atypischer Beschäftigung werden im Kontrast alle Formen verstanden, die hiervon abweichen, z.B. Selbstständige, Teilzeitbeschäftigte und Freiberufler:innen. Die Gruppe der prekär Beschäftigten ist hingegen nicht so genau definiert und es existieren unterschiedliche Vorstellungen davon, was prekär bedeutet. Gemein ist allen Definitionen jedoch ein Fokus auf Unsicherheit, sei es finanzielle, vertragliche oder rechtliche Unsicherheit. In meiner Studie blicke ich vor allem auf finanzielle Unsicherheit und fasse in dieser Gruppe alle Beschäftigten zusammen, die nicht mindestens sechs Monate von ihren Ersparnissen leben könnten und deren finanzielle Situation es nicht zulässt, Rücklagen zu bilden.
Ein Blick auf die soziodemografischen Merkmale dieser beiden Gruppen offenbart, dass Frauen in beiden Gruppen (deutlich) überrepräsentiert sind. Während rund 60 Prozent der prekär Beschäftigten weiblich sind, sind es in der Gruppe der atypisch Beschäftigten sogar 75 Prozent. Dies lässt sich vor allem auf den hohen Anteil der Teilzeitbeschäftigung bei Frauen zurückführen. In doppelter Hinsicht auffällig ist außerdem die Verteilung von Bildungsabschlüssen in diesen beiden Gruppen: Zum einen unterscheiden die beiden Gruppen sich untereinander extrem. Während von den prekär Beschäftigten rund 37 Prozent einen Hauptschulabschluss und weitere 40 Prozent die Schule mit mittlerer Reife abgeschlossen haben, haben von den atypisch Beschäftigten rund 36 Prozent Abitur oder sogar einen (Fach-)Hochschulabschluss. Zum anderen fällt auf, dass die atypisch Beschäftigten – mit kleinen Abweichungen – der Bildungsverteilung in der deutschen Gesamtbevölkerung entsprechen. Die prekär Beschäftigten hingegen sind im Durchschnitt deutlich schlechter gebildet. Basierend auf dieser Verteilung ist also davon auszugehen, dass das Bildungsniveau einer Person nicht nur entscheidend beeinflusst, ob sie prekär beschäftigt ist oder nicht, sondern auch wie wahrscheinlich es ist, dass sie aus einem solchen Beschäftigungsverhältnis rausschafft. Es zeigt sich erneut, dass Bildung entscheidend ist – insbesondere in einem Sozialstaat, der verstärkt auf sogenannte Social Investment Policies setzt, also Bildungs- und Arbeitsanreize vor Kompensationszahlungen bevorzugt.
Wie nehmen prekär und atypisch Beschäftigte ihre soziale Klasse wahr?

Neben der Zusammensetzung der einzelnen Beschäftigungsgruppen, steht im Fokus der Untersuchung jedoch die Frage, wie diese ihre eigene soziale Schicht wahrnehmen und ob sie sich subjektiv der Arbeiter:innenklasse zugehörig fühlen. Dabei fällt vor allem bei den prekär Beschäftigten auf, dass viele sich trotz ihrer schwierigen Lebensrealitäten der Mittelschicht zuordnen – ein Phänomen, das als „Mittelschichtsbias“ bekannt ist. Abbildung 1 zeigt die subjektive Schichtzugehörigkeit für die Gruppen der prekär und atypisch Beschäftigten jeweils gruppiert danach, ob sie sich der Arbeiter:innenklasse zugehörig fühlen oder nicht [2].
Auffällig ist, dass sich die prekär Beschäftigten unabhängig von ihrer subjektiven Schichtzugehörigkeit in der großen Mehrheit der Arbeiter:innenklasse zugehörig fühlen, während dies bei den atypisch Beschäftigten nicht so deutlich der Fall ist. Die Ergebnisse verdeutlichen also, dass das Zugehörigkeitsgefühl zur Arbeiter:innenklasse weitestgehend entkoppelt zu sein scheint von der subjektiven Schichtzugehörigkeit. Mit Blick auf Aussagen von Fokusgruppenteilnehmenden (s. oben) wird deutlich, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl vielmehr von der tatsächlichen Tätigkeit oder dem Sektor abzuhängen scheint. Betrachtet man nämlich nur diejenigen, die sich der Arbeiter:innenklasse zugehörig fühlen und gruppiert diese nach ihren Berufsgruppen, zeigt sich sowohl für die prekär als auch die atypisch Beschäftigten ein interessantes Bild.

Unter den prekär Beschäftigten fühlen sich vor allem Produktionsarbeiter:innen sowie Angestellte in einfachen Dienstleistungsberufen – wie etwa in der Reinigung oder im Verkauf – der Arbeiter:innenklasse zugehörig, beide Berufsgruppen machen jeweils rund ein Viertel der prekär Beschäftigten aus. Bei den atypisch Beschäftigten sind es insbesondere Menschen in Dienstleistungsberufen (27 Prozent) sowie sogenannte soziokulturelle Fachkräfte – also etwa Lehrer:innen oder Sozialarbeiter:innen – mit 18 Prozent. In beiden Gruppen zeigt sich also ein klarer Zusammenhang zwischen dem beruflichen Tätigkeitsfeld und dem Gefühl, zur Arbeiter:innenklasse zu gehören. Diese Muster deuten darauf hin, dass sich trotz veränderter Arbeitsmärkte bestimmte Berufsfelder weiterhin stark mit klassenspezifischer Zugehörigkeit verbinden.
Implikationen für Politik und Gesellschaft
Die Studie endet mit Handlungsempfehlungen für die Politik, um der verbreiteten Absteigsangst vor allem unter den prekär Beschäftigten entgegenzuwirken. Basierend auf den Analyseergebnisse empfehle ich zum einen die Stärkung von sozialen Sicherungssystemen, um finanziell unter Druck stehende Beschäftigte zu unterstützen und ihre (akute) Situation zu verbessern. Zum anderen unterstreichen die Ergebnisse die Bedeutung von guter (Aus-)Bildung. Es wäre daher erstrebenswert, wenn die Politik mehr in Programme für gute und lebenslange Aus- und Weiterbildung investiert. Darüber hinaus betonen vor allem die atypisch Beschäftigten die Wichtigkeit einer nachhaltigen und generationengerechten Rente. Die Politik sollte hier insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Altersvorsorge für Teilzeitbeschäftigte in den Blick nehmen, denn es sind vor allem Mütter, die häufig in Teilzeit arbeiten und keine armutssicheren Rentenansprüche aufbauen.
Fazit: Vielfalt innerhalb von Klassen und Schichten
Die Untersuchung macht deutlich, dass prekär und atypisch Beschäftigte in Deutschland keine homogene Gruppe darstellen, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Lebenslagen, Selbsteinschätzungen und politischen Präferenzen aufweisen. Viele prekär Beschäftigte fühlen sich trotz ihrer schwierigen Lebensrealitäten der traditionellen Arbeiter:innenklasse verbunden, ordnen sich jedoch subjektiv häufig der gesellschaftlichen Mitte zu. Politisches Potenzial für solidarisches Handeln zeigt sich vor allem dort, wo existenzielle Ängste und der Wunsch nach mehr sozialer Sicherheit zusammentreffen. Für eine solidarische und gerechte Gesellschaft ist es nun entscheidend, die bislang unsichtbaren Stimmen dieser Arbeitswelten sichtbar zu machen und aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen konkrete politische Maßnahmen zu entwickeln, die den vielstimmigen Alltag prekärer und atypischer Erwerbsformen ernst nehmen.
[i] Diese Fokusgruppengespräche wurden im Rahmen des Projekts „Kartografie der Arbeiter:innenklasse“ durchgeführt. Bei dem Projekt der Friedrich-Ebert-Stiftung handelt es sich um den Versuch, eine Vermessung der (erwerbs-)arbeitenden Gesellschaft in Deutschland vorzunehmen. Weitere Informationen und Publikationen des Projekts finden sich hier: https://www.fes.de/sozial-und-trendforschung/Arbeiter:innenklasse
[ii] Hinweis zu Abb. 1: Die Balken zeigen die jeweilige subjektive Zugehörigkeit zur Arbeiter:innenklasse innerhalb der sieben Schichten an. Dass sich 100 Prozent der prekär Beschäftigten, die sich der obersten Schicht zurechnen auch der Arbeiter:innenklasse zugehörig fühlen, ist auf die sehr kleine Fallzahl in dieser Gruppe (5 Befragte) zurückzuführen.
Zitation: Johanna Plenter, Warum „soziale Klasse“ heute noch zählt, Erschienen in „Über Politik aus der Wissenschaft“, Herausgeber Achim Goerres, 28.07.2025, abrufbar unter https://www.politik-wissenschaft.org/2025/07/28/social-class/, DOI: https://doi.org/10.17185/politik-wissenschaft/20250811